
Drosera '98 (2): 123-126, Oldenburg.
[back]
 | published in: Drosera '98 (2): 123-126, Oldenburg. [back] |
Danny Wolff
Abstract: Pipiza accola Violovitsh, 1985 is reported as new to Germany on the base of recent captures in Lower Saxony and Baden-Württemberg.
Seit mehreren Jahren arbeitet der Autor an einer Untersuchung über die Schwebfliegenfauna bodenfeuchter Laubwälder in der Lüneburger Heide. In 2 von 6 Untersuchungsgebieten wurden Exemplare einer Pipiza-Art gefangen, die den aus Mitteleuropa bekannten Arten nicht zugeordnet werden konnten.
Nach einem Hinweis von Herrn Doczkal, Malsch, daß es sich um eine aus Europa bisher unbekannte, offenbar eng mit P. luteitarsis Zetterstedt, 1843 verwandte Art handelt, wurden 2 Männchen und 2 Weibchen Herrn Claußen, Flensburg, zur Überprüfung übersandt. Nach einem Vergleich mit Material der beiden eng mit luteitarsis verwandten Arten P. accola Viol. 1985 und P. aurea Viol. 1985 aus dem östlichen Sibirien teilte dieser folgendes mit:
"Nach Vergleich Ihrer Tiere mit Material von Pipiza accola Viol. aus dem östlichen Sibirien komme ich zu dem Schluß, daß Ihre Pipiza (trotz geringfügiger Unterschiede) zu accola gehört. Die Gemeinsamkeiten mit der sehr typischen accola sind fast 100 %ig. ... Ob eventuell eines der zahlreichen Synonyme für die europäischen Pipiza-Arten ein älterer Name für P. accola sein kann, läßt sich wohl erst entscheiden, wenn jemand die europäischen Arten der Gattung gründlich bearbeitet - aber da ist meines Wissens niemand in Sicht."
Zwischen 2 Männchen aus Sibirien und 1 Männchen aus der Lüneburger Heide konnte er folgende Unterschiede feststellen, die aber noch in dem für die Gattung üblichen Variationsbereich liegen (Claußen, in litt.):
| - | Stirn bei den sibirischen Belegtieren geringfügig stärker aufgequollen, | |
| - | Zellen der Flügelbasis (z.B. Basis der 2. Costalzelle, Basis der 2. Basalzelle) bei diesen Tieren teilweise ohne Mikrotrichien, während bei dem Beleg aus Niedersachsen die 2. Costalzelle etwas ausgedehnter "behaart" und die 2. Basalzelle vollständig "behaart" ist, | |
| - | Hypandrium ist bei den sibirischen Belegen geringfügig kürzer. |
Mit luteitarsis hat accola die fehlende Schenkelfurche beim 3. Beinpaar, die sehr feine Punktierung und die feine, überwiegend helle Behaarung gemeinsam. Anhand der in der Tabelle 1 aufgeführten Merkmale lassen sich die beiden Arten jedoch gut trennen.
In dem russischen Bestimmungsschlüssel von Violovitsh (1988) erfolgt die Trennung der beiden Arten bereits beim ersten Merkmalspaar (Färbung der Tarsen). Hinsichtlich der Färbung der vorderen Tarsen gibt es jedoch Übergänge. Einzelne Tiere von luteitarsis können auf der Oberseite der vorderen Tarsen leicht verdunkelt sein, während die dort normalerweise gebräunte accola in seltenen Fällen nur kaum sichtbare Bräunungen besitzt (frisch geschlüpfte Exemplare ?). Dieses Merkmal sollte daher nur in Kombination mit den genannten Merkmalen verwendet werden.
Tab. 1: Morphologische Merkmale zur Trennung von luteitarsis und accola
| luteitarsis | accola | |
| Männchen | Surstylus
an der Basis ohne Lobus und ohne starke Beborstung (Abb. 4), in Aufsicht im basalen Drittel
nur wenig breiter als im Spitzendrittel; Die Surstyli
bilden mit dem Epandrium in Seitenansicht einen stumpfen
Innenwinkel, der deutlich größer als 90° ist (Abb. 5). Gesicht in Höhe der Fühlerbasis etwas schmäler als ein Auge in gleicher Höhe, der Augenwinkel beträgt daher etwa 90°. | Surstylus
an der Basis mit kurzem, aber deutlichen Lobus (Abb. 1), letzterer auf der Innenseite mit
starker Beborstung, Surstylus in Aufsicht im basalen
Drittel deutlich breiter als im Spitzendrittel (Abb. 2); Die Surstyli bilden mit dem
Epandrium in Seitenansicht einen annähernd rechten
Innenwinkel (Abb. 3). Gesicht in Höhe der Fühlerbasis etwas breiter als ein Auge in gleicher Höhe, der Augenwinkel ist daher größer als 90° (ca. 100°). |
| Weibchen | 5.
Hinterleibstergit etwa so lang wie an der Basis breit (Abb. 6); Stirnflecken größer, nehmen an ihrer breitesten Stelle zusammen ca. die Hälfte der Stirnbreite ein. | 5.
Hinterleibstergit deutlich breiter als lang (Abb. 7); Stirnflecken kleiner, nehmen an ihrer breitesten Stelle zusammen ca. ein Viertel bis ein Drittel der Stirnbreite ein. |
Die Mehrheit der Tiere wurden im Klein Hesebecker Bruch (ca. 3 km südöstlich von Bad Bevensen) gefangen: 1 w 06.05.1992, 2 w 12.05.1994, 1 m, 1 w 24.04.1995, 1 m, 3 w 01.05.1995, 2 m, 1 w 02.05.1995. Die übrigen Belege wurden im Söhlbruch bei Grünhagen (ca. 2 km westnordwestlich von Bienenbüttel) gesammelt: 2 w 05.05.1995. Wie bei luteitarsis handelt es sich offenbar um eine bereits im zeitigen Frühjahr fliegende Art. Die genauen Fundumstände (z.B. Blütenbesuch oder "Sonnen" auf jungem Laub) wurden leider nicht notiert.
Bei beiden Fundorten handelt es sich um Bestände des Traubenkirschen-Erlen-Eschenwaldes (Pruno-Fraxinetum Oberd. 1953), die eine gut entwickelte Kraut- und Strauchschicht aufweisen. Im Söhlbruch tritt basenreiches Hangdruckwasser fast bis an die Oberfläche. Der überwiegende Anteil kann daher der Subassoziation von Bingelkraut (Pruno-Fraxinetum mercurialetosum) zugerechnet werden (vgl. Dierschke et al. 1987). In der Baumschicht dominiert die Esche (Fraxinus excelsior). Geringere Deckungsgrade erreichen Stieleiche (Quercus robur), Bergahorn (Acer pseudoplatanus), Schwarzerle (Alnus glutinosa) und Flatterulme (Ulmus laevis). Auf kleinflächigen, oft nur wenige Dezimeter hohen Kuppen tritt außerdem die Rotbuche (Fagus sylvatica) hinzu, die allerdings keinen festen Stand erlangt und meist bereits im mittleren Alter von Stürmen geworfen wird.
Im Klein Hesebecker Bruch herrscht auf ebenem, mehr oder weniger grundwassernahen Standort die Subassoziation des Geißblattes vor (Pruno-Fraxinetum loniceretosum) mit Dominanz von Schwarzerle in der Baumschicht (vgl. ebenda). Der Klein Hesebecker Bruch besitzt allerdings ein ausgeprägtes Kleinrelief und weist in verschiedenen Teilen auch Bestände der Eichen-Hainbuchenwälder (Carpinion betuli) und Erlenbrücher (Alnion glutinosae) auf.
Ferner konnte accola auch für 3 Fundorte in Süd-Deutschland bestätigt werden: 1 w 09.04.1993, Baden-Württemberg, Freiburg, Mooswald Gottenheim, Stuke leg.; 1 m 14.04.1993, Baden-Württemberg, Freiburg, Mooswald Lehen, Stuke leg. sowie 1 m 13.04.1990, Baden-Württemberg, Lilienthal (Mühlental) im Kaiserstuhl, Stuke leg.. Bei allen 3 Fundorten handelt es sich ebenfalls um bodenfeuchte Laubwälder (Stuke, mdl. Mitt.). Die beiden Tiere aus dem Mooswald haben dem Autor zur Überprüfung vorgelegen.
Für Mitteleuropa liegt bisher keine gründliche Bearbeitung der Gattung Pipiza vor. In den Bestimmungsschlüsseln westeuropäischer Autoren (z.B. Goot 1981, Stubbs & Falk 1986, Torp 1994 oder Verlinden 1991) ist accola nicht enthalten. Da bisher außerdem überwiegend mit recht unzuverlässigen - weil sehr variablen - Merkmalen gearbeitet wird (z.B. Färbung der Beine bzw. Tarsen, Größe der Hinterleibsflecken, Stärke der Flügeltrübung), würde es nicht verwundern, bei Durchsicht größerer Sammlungen (insbesondere unter Material von P. noctiluca (Linnaeus, 1758) und P. signata Meigen, 1822) weitere Exemplare von accola aus Deutschland bzw. Europa zu entdecken. 2 Belegtiere befinden sich in der Sammlung Claußen, die übrigen Belege in der Sammlung des Autors.
Zusammenfassung: Pipiza accola Violovitsh 1985 wird aufgrund aktueller Funde aus Niedersachsen und Baden-Württemberg erstmals für Deutschland gemeldet.
Danksagung:
Ich danke den Herren D. Doczkal, Malsch, und C. Claußen, Flensburg, für die Überprüfung bzw. Bestimmung von Pipiza accola-Belegexemplaren. Herrn Claußen danke ich außerdem für die kritische Durchsicht des Manuskripts, für wertvolle Hinweise zur Trennung von accola und luteitarsis sowie für die Anfertigung der Genitalzeichnungen. Herrn J.H. Stuke, Aurich, danke ich für die Ausleihe von Belegexemplaren und Informationen zu den von ihm mitgeteilten Fundorten.
Literatur:
Dierschke, H., Döring, U. & Hüners, G. (1987): Der Traubenkirschen-Erlen-Eschenwald (Pruno-Fraxinetum Oberd. 1953) im nordöstlichen Niedersachsen. - Tuexenia 7: 367 - 379, Göttingen.
Goot, V.S. van der (1981): De zweefvliegen van Noordwest - Europa en Europees Rusland, in het bijzonder van de Benelux. 275 S. Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging, Hoogwoud.
Stubbs, A.E. & Falk, St. (1986): British Hoverflies, an illustrated identification guide. British Entomological and Natural History Society, London.
Torp, E. (1994): Danmarks svirrefluer (Diptera: Syrphidae). Danmarks Dyreliv 6. Stenstrup: Apollo Books.
Verlinden, L. (1991): Fauna van Belgie, Zweefvliegen (Syrphiden). 298 S. Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, Brüssel.
Violovitsh, N.A. (1985): [New species of the genus Pipiza Flln. (Diptera, Syrphidae) of the Palaearctic fauna.] - In: G.S. Zolotarenko (ed.): [Arthropods of Siberia and the Soviet Far East.] Nauka, Novosibirsk, 199 - 207. [russisch]
Violovitsh, N.A. (1988): [Kurze Übersicht der paläarktischen Arten der Gattung Pipiza Fallén (Diptera, Syrphidae).] - Taksonomyia i ekologiya zhivotnykh Sibiri. Novye i maloizvestnye vidy fauny Sibiri [Taxonomie und Ökologie der Tiere Sibiriens. Neue und wenig bekannte Arten aus der sibirischen Fauna.] 20: 108 - 126. Novosibirsk; Nauka. [russisch]
Anschrift des Autors:
Danny Wolff
Lönsstraße 1a
D - 29574 Ebstorf
| Abb.1: Pipiza
accola VIOL. (Niedersachsen) Apikalhälfte des Epandriums, dorsal | 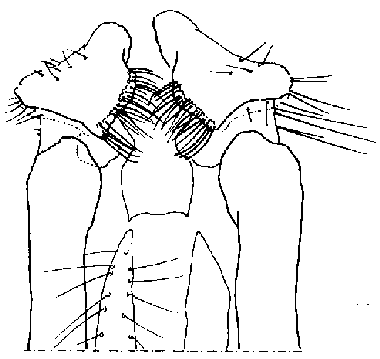 |
| Abb. 2: Pipiza
accola VIOL. (Niedersachsen) Surstylus, von oben | 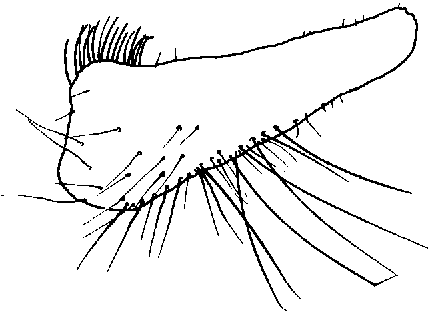 |
| Abb. 3: Pipiza
accola VIOL. (Niedersachsen) Surstylus, lateral | 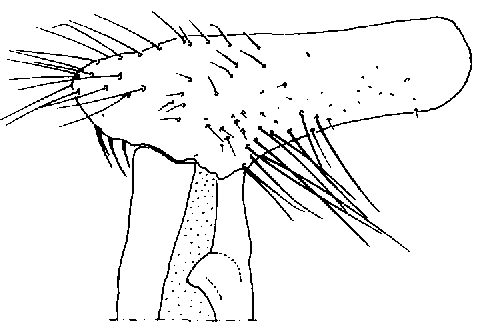 |
| Abb. 4: Pipiza
luteitarsis ZETT. (Schleswig-Holstein) Apikalhälfte des Epandriums, dorsal | 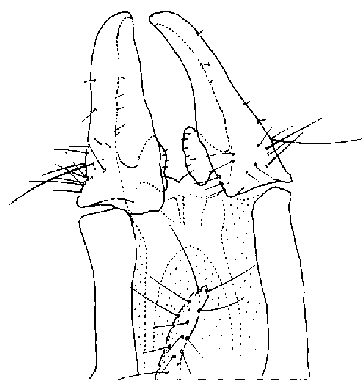 |
| Abb. 5: Pipiza
luteitarsis ZETT. (Schleswig-Holstein) Surstylus, lateral | 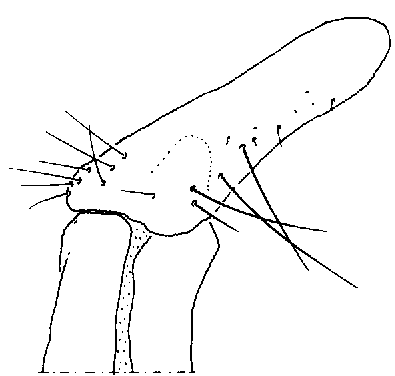 |
| Abb. 6: Pipiza luteitarsis ZETT. , Weibchen, 5. Hinterleibstergit (schematisiert) | 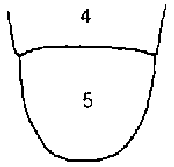 |
| Abb. 7: Pipiza accola VIOL. , Weibchen, 5. Hinterleibstergit (schematisiert) | 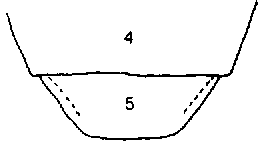 |